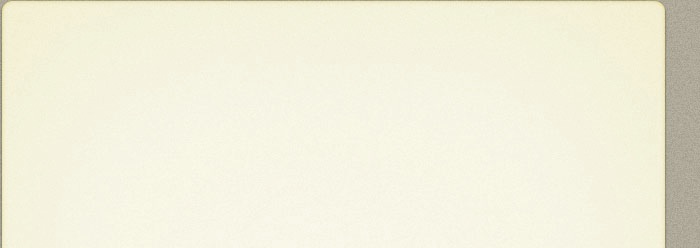-
5.bis 7. März 2010, Hochschule für Gestaltung, Karlsruhe
» … aucun analyste ne peut s’autoriser sous aucun angle à parler du normal, de l’anormal non plus d’ailleurs.«
» … in keinerlei Hinsicht kann ein Psychoanalytiker es sich erlauben, vom Normalen zu reden, ebensowenig übrigens vom Anormalen.« (J. Lacan)
Die Frage nach Norm, Normalität und Gesetz ist für die Psychoanalyse von grundlegender Bedeutung. Nicht nur in Bezug auf die ihre Geschichte begleitenden Versuche, Standards ihrer Ausübung zu entwickeln, und nicht nur wegen der ständigen Normierungsversuche, denen die Psychoanalyse ausgesetzt ist. Schon im Freud‘schen Werk taucht der Begriff der Norm häufig auf. Kann man diesen auf den normalen Ablauf einer Funktion reduzieren? Und was soll es heißen, wenn Lacan davon spricht, dass die Analyse zu einer Normativierung des Ödipuskomplexes führt? Welcher Unterschied besteht zwischen Normalisierung und Normativierung? Ist die Psychoanalyse schlicht und einfach außerhalb jeder bestehenden Norm anzusiedeln? Oder, welchen Normen ist sie unterworfen? Was sagt es dem Psychoanalytiker wenn seine Analysanten von normalen Zuständen, normalem Verhalten usw. sprechen? Welche Begriffe von Norm sind am Werk, wenn etwa Neurowissenschaftler zur Psychoanalyse Stellung nehmen?
Was meinen Psychoanalytiker, wenn sie von Gesetz sprechen – im Unterschied zum juridischen Begriff? Oder haben die verschiedenen Diskurse jeweils verschiedene Normen und Gesetze? Gibt es eine »allgemeine Theorie der Normen« wie sie etwa Hans Kelsen vorgeschlagen hat? Welchen Normen folgt z.B. Freuds Aufsatz über die »Laienanalyse«, in dem er versucht, einem »Unparteiischen« die Psychoanalyse verständlich zu machen? Ist etwa die Verständlichkeit des psychoanalytischen Vorgehens eine normative Bedingung, die sie gegenüber den Wissenschaften einzulösen hat?
Mehr denn je sind wir dazu aufgefordert die Position der Psychoanalyse gegenüber der Öffentlichkeit und der Politik der Psychotherapie zu erläutern. Die Auseinandersetzung mit den hier skizzierten Fragen ist umso drängender geworden, als die theoretischen Voraussetzungen der Psychoanalyse vielfach in Frage gestellt werden. Wie würde eine Relektüre ihrer Grundbegriffe in einem – gegenüber Freud und Lacan – völlig veränderten diskursiven Umfeld aussehen?
Folgende Themen stehen zur Diskussion:
| Standardisierung und Normierung in Psychoanalyse und Psychotherapie
| Politik der Psychoanalyse / Psychoanalyse der Politik
| Subversion der Normalität und klinische Theorie
| Das Gesetz und das Reale
| Kunst, Norm, Transgression
| Jenseits der Verordnung
Mit Beiträgen von:
Michael Bartsch (Karlsruhe) Cristina Burckas (Freiburg) Gabrielle Devallet-Gimpel (Toulouse) Miriam Goretzki-Wagner (Köln) Britta Günther (Hamburg) Annemarie Hamad (Paris) Christian Kläui (Basel) Anna-Elisabeth Landis (Böblingen) Michael Meyer zum Wischen (Köln) André Michels (Luxemburg/Paris) Peter Müller (Karlsruhe) Karl-Josef Pazzini (Hamburg) Dietrich Pilz (Berlin) Werner Prall (London) Claus-Dieter Rath (Berlin) Karin Schlechter (Köln) Michael Schmid (Bregenz) Marianne Schuller (Hamburg) Bernhard Schwaiger (Neustrelitz) Jean-Renaud Seba (Liège) Peter Sloterdijk (Karlsruhe) Christoph Tholen (Basel) Anna Tuschling (Basel) Rivka Warshawsky (Tel Aviv) Peter Weibel (Karlsruhe) Peter Widmer (Zürich)
Kongressprogramm
Freitag, 5. März 2010, 18.00 – 22.00 Uhr
ab 18.00
Einschreibung
19.00
Peter Müller: Begrüßung und Einführung
19.15
André Michels: Zur Kritik der normativen Vernunft
19.45
Bernhard Schwaiger: ›Strafbedürfnisse‹ – Jugendstrafvollzug zwischen Norm und Gesetz
20.15
Diskussion mit Michael Bartsch, Jean-Renaud Seba und Christoph Tholen
Moderation: Peter Müller
21.30
Kleiner Empfang in der Eingangshalle der HfG
Samstag, 6. März 2010, 9.00 – 18.00 Uhr
9.00 – 11.00
Standardisierung und Normierung in Psychoanalyse und Psychotherapie
Diskussionsrunde mit Gabrielle Devallet-Gimpel, Anna-Elisabeth Landis, Werner Prall, Rivka Warshawsky
Leitung: Michael Meyer zum Wischen
11.00 – 11.30
Pause
11.30 – 12.00
Peter Widmer: Norm und Normalität in Theorie und Praxis
12.00 – 12.30
Claus-Dieter Rath: Stimmen die Werte? Zum »genügend unpersönlich gewordenen« Überich bei Freud
12.30
Diskussion der Vorträge mit Anna Tuschling und Michael Schmid
13.30 – 15.00
Mittagspause
15.00 – 16.30
Freudsche Figuren des Gesetzes
Britta Günther: Reiz der Interpunktion: Gesetzestreue und Textlücke bei Schreber
Anna Tuschling: Angst vor dem Gesetz
Marianne Schuller: Das Gesetz und das Komische
Diskussion mit Christian Kläui und Peter Sloterdijk
16.30 – 17.00
Pause
17.00 – 18.00
Medizin und Gesetz
Cristina Burckas: Das Unbehagen in der Medizin
Dietrich Pilz: Zu den Namen-des-Vaters. (Fragen zur Normativierung im psychoanalytischen Prozess)
Diskussion mit Michael Meyer zum Wischen
19.00
Gelegenheit zum gemeinsamen Abendessen (Lokal wird noch angegeben)
Sonntag, 7. März 2010, 9.30 – 13.15 Uhr
9.30 – 10.00
Karl-Josef Pazzini: Übertragung als Auflösung des Individuums. Störung einer bürgerlichen Norm
10.00 – 11.00
Kunst, Norm und Transgression. Subversion und Unbewusstes
Karin Schlechter: In einen Ort fallen und ihn währenddessen aufzeichnen
Annemarie Hamad: Norm und Heterogenität
Diskussion mit Peter Weibel und Karl-Josef Pazzini
11.30 – 11.45
Pause
11.45 – 13.00
Jenseits der Verordnung
Abschlussdiskussion: Christian Kläui, André Michels, Peter Müller, Claus-Dieter Rath
13.15
Ende der Tagung
Vorträge
Michael Meyer zum Wischen: Standardisierung und Normierung in Psychoanalyse und Psychotherapie
Die Praxis der Psychoanalyse und der von ihr geprägten Psychotherapieformen ist immer stärker einer Forderung nach Standardisierung ausgesetzt, die im Kontext umfassenderer gesellschaftlicher Normierungsprozesse einzuordnen ist. Hieraus ergeben sich für Psychoanalytiker ethische Konflikte, die wir im Rahmen unseres Round-Table Gesprächs befragen wollen. Darüber hinaus gibt es aber nicht nur den der Psychoanalyse von äußeren Instanzen auferlegten normativen Druck und entsprechende Standardisierungsdispositive, sondern auch in den psychoanalytischen Gemeinschaften selbst herrschende Vorstellungen von Normalität und Normierung, durchaus auch Ideen von einer »Standard-Kur«. Diese innere Gefährdung der Psychoanalyse verdient in unserem Gespräch besondere Aufmerksamkeit, da sie auf eine Art Selbstzerstörung hinauslaufen könnte und den gesellschaftlichen Tendenzen entgegenkommt, die die Psychoanalyse für ihre normativen Zwecke instrumentalisieren wollen. Hierzu gehören sowohl medizinische, politische und besonders auch juristische Vereinnahmungen der Psychoanalyse.
Anna Tuschling: Angst vor dem Gesetz?
Der Beitrag erörtert das Verhältnis von Angst und Gesetz. Keineswegs ist die Angst – nach Lacan das Signal des Realen – jedem Gesetz und auch jeder Norm vorgängig: Die Angst vor dem Gesetz steht gerade zur Debatte. Genausowenig resultiert die Angst einfach aus Verbot, Strafandrohung und Gesetz; vielmehr wird die gegenseitige Bedingtheit und Gleichursprünglichkeit von Gesetz und Angst auszuloten sein, welche Kierkegaard bereits in seiner Diskussion des Sündenfalls konturiert
Annemarie Hamad: Norm und Heterogenität
Ist es das Heterogene, was die Norm immer wieder umwirft und deren Neuformulierung veranlaßt? Ausgangspunkt ist die Konkretisierung des Heterogenen in Kurt Schwitters Merzbildern. Das führt weiter zur »art brut« und der Notwendigkeit, Neuordnungen aus dem von der Technologie geschaffenen Abfall (im konkreten wie auch im symbolischen Sinn) zu erfinden und herzustellen. Diesbezügliche Fragen werden hauptsächlich von der Klinik her angegangen.
Peter Widmer: Norm und Normalität in Theorie und Praxis
Welche Normativität enthält die Grammatik? Vor dem Hintergrund eines Vergleichs zwischen den westlichen Sprachen und dem Japanischen wird dieser Frage nachgegangen. Was heisst es z.B., wenn eine Sprache keine Konjugationen kennt, d.h. wenn sich die 1. Person Singular grammatikalisch nicht von den Formen des Plural unterscheidet? Liegt hier der Schlüssel zu einem anderen Denken und Empfinden, das als kollektiv bezeichnet wird? Und was heisst das in Bezug auf die in der Psychoanalyse so bedeutsame Singularität?
Cristina Burckas: Das Unbehagen in der Medizin
Die zunehmende Verwissenschaftlichung der Medizin im 19. Jahrhundert hat zu einem Unbehagen geführt, das sich vor allem in den Symptomen niederschlug, denen der Arzt in Ausübung seiner Praxis begegnete. Indem es Freud gelang, den Appell des Subjekts zu hören, der in den Symptomen insistierte, erfand er die Psychoanalyse.
Die Freudsche Psychoanalyse ist in der Abgrenzung von der Medizin entstanden. Diese Abgrenzung ist auch weiterhin das, was die Psychoanalyse definiert und woran sie sich orientieren kann. Doch seit der Entstehung der Psychoanalyse haben sich die Verhältnisse in der Medizin erheblich verändert. Wissenschaftliche Fortschritte im Zusammenspiel mit wirtschaftlichen und politischen Interessen haben zu einer ständig wachsenden Komplexität beigetragen, der nun durch eine wahre Flut von Reglungen und Normierungen beizukommen versucht wird.
Welchen Stellenwert kann also diese Abgrenzung unter den heutigen Bedingungen haben? Das ist die Frage, die sich mir in diesem Zusammenhang stellt. Die Praxis der Psychoanalyse hat mich vor einiger Zeit vor eine Situation gestellt, in der ich mich gezwungen sah, mich grundsätzlich mit dieser Frage zu beschäftigen.
Karl-Josef Pazzini: Übertragung als Auflösung des Individuum. Störung einer bürgerlichen Norm
Mit der Wahrnehmung und Konzeptionalisierung der unbewussten Übertragung stellt Freud, und in der Folge Lacan, die zur Norm gewordene Entität eines substanziellen Individuums infrage. Schon mit der Formulierung von Projektion, Identifizierung und Introjektion könnte man das »autonome« Individuum in einer dauernden Relation zu Nebenmenschen und zur Umwelt sehen, die schwerlich noch mit einer Vorstellung von Autonomie vereinbar sind. Die Zurechenbarkeit von Denken, Sprechen und Handeln erweist sich also notwendig fiktional. Das eröffnet die Notwendigkeit, vieles neu denken zu müssen.
Britta Günther: Reiz der Interpunktion. Gesetzestreue und Textlücke bei Schreber
Wie eine »Interpunktion ohne Text« erscheint im Realen, was nicht »ans Tageslicht des Symbolischen« gedrungen ist. Lacans Metapher für die verworfene Kastration aus seiner Antwort auf den Kommentar von Jean Hyppolite über die «Verneinung» von Freud ermöglicht einen Zugang zur »Weltordnung« in Schrebers Denkwürdigkeiten, insbesondere zu den Unterbrechungen im Text. Wenn Schreber, der sich einem gewalttätigen Gott ausgeliefert sieht, der ihn zu sexueller Hingabe und zur körperlichen Entleerung zwingt, vom »f…..« und »sch…..« schreibt, können diese Punktierungen in einer ersten Lektüre als Arbeit an der Herstellung einer Lücke, mithin als Anerkennung von Kastration und Gesetz im Schreibakt gelesen werden. Im Weiteren könnte jedoch gerade die Bauweise dieser Lücken in Schrebers Text, ihre Erscheinungsweise als Euphemismen (als »milde Umschreibungen«) das Tageslicht des Symbolischen des frühen Lacan-Textes mit einem Schatten versehen: Dergestalt, dass die Anerkennung des Gesetzes, verstanden als Einschreibung des Symbolischen, noch keinen Akt darstellt, da dieser vielmehr eine Transgression des Gesetzes fordert. »Wenn es aber eines Tages darum geht, daß ich eine bestimmte Schwelle überschreite, womit ich mich außerhalb des Gesetzes stelle, dann wird meine Motrizität an diesem Tag den Wert eines Akts haben« (Lacan, Seminar XV, Der psychoanalytische Akt, 1967/68).
Christian Kläui: Jenseits der Verordnung
Bei Debatten um Norm und Gesetz steht immer wieder die Medizin im Fokus: Biopolitik, Fortpflanzungstechnologien, hygienepolizeiliche Massnahmen, Lifestylemedizin, Rationierungsmassnahmen … Die Psychiatrie stand in ihrer Doppelfunktion als ordnungspolizeiliche und schutzgebende Instanz lange Zeit als das »schmutzige Kind« der Medizin etwas im Abseits. Heute ist sie zunehmend eingebunden in die normativierenden medizinischen Diskurse: Marktkonforme Profilierung mit Spezialangeboten, »gute« psychiatrische Kliniken als Wellnessoasen für Ausgebrannte, Psychopharmaka als Lifestyledrogen, Ritalin-kids … (Und daneben, wie gehabt, die »schmutzigen« Abteilungen für die Psychotiker). Die Psychotherapie stand lange Zeit im Ruf, die »menschliche« Abteilung der Psychiatrie zu sein: ambulant, freiwillig, an »Selbstverwirklichung« interessiert. Doch die Freudsche Psychoanalyse ist nicht so gestartet, sie war von ihrem Anspruch her viel näher an dem, was heute die VT vertritt: eine effiziente, an klinischer, symptomatischer Besserung und Heilung interessierte Methode zu sein. Natürlich hat Freud diesen Anspruch immer wieder neu diskutiert und bestimmt – das »Junktim von Heilen und Forschen« hat er indes nie aufgegeben. Psychoanalyse »jenseits der Verordnung« – jenseits des Medizinalsystems und jenseits des Heilens als Anspruch einesteils und Anpassung andernteils – ist ein Ideal, dem wir gelegentlich nahe kommen können, das aber die Realität der Verstrickung von psychoanalytischer Praxis und Gesundheitsversorgung nicht erfasst. Auf der andern Seite des Spektrums entdeckt die Philosophie zunehmend die »ars vivendi« und wirft philosophische Therapien – jenseits der Verordnung – auf den Markt. In dieser Landschaft
stellt sich für die Psychoanalyse die Frage des Junktim immer wieder neu und sie stellt sich ihr immer auch als Frage nach ihrer Positionierung auf dem Markt einerseits und – davon nie unabhängig – als Frage nach ihren eigenen inneren Normen und damit als Frage nach den Vorstellungen, die sie vom Ende der Kur hat.
Karin Schlechter: In einen Ort zu fallen und ihn währenddessen aufzeichnen
Ich werde etwas zu meiner künstlerischen Arbeit, meiner Arbeitsweise sagen, und auch zur Arbeit in der SCHULE DES BEGEHRENS, die ich 2005 gegründet habe, sprechen. Mein fortlaufendes künstlerisches Projekt, das aus Raumsituationen, Videoinstallationen und poetischen Texten besteht, bezeichne ich als »Aufzeichnungen aus der Zone O«. Es handelt sich um eine Bewegung des Hervorbringens oder der Niederschrift von etwas, das nicht angegeben werden kann und sich aus einem Ort heraus formuliert, der mit O benannt wird.
Diesem Ort möchte ich zuhören können wie einer anderen, fremden Sprache. Ich versuche, mir Zeichensysteme oder verschiedene Medien vorzustellen, die dieses Andere übermitteln. Es interessiert mich auch, Versionen bestimmter Ortszustände zu erproben und aufzuzeichnen.
Der Ort der Transgression z.B. als ein parallaktischer Ort der Überschreitung. Das ist vielleicht da, wo ein begrenzter Ort zugleich als grenzenlos erlebt werden kann, wo es um Präzision in einem Feld des Unbestimmbaren geht.
Am Rand, im Übergang selbst ereignet sich der »Ort«.
Das Unmögliche versuchen: diesen Ort sich selber sagen zu lassen.
Ansonsten: Nichts zu sagen zu haben – nichts, was der Geste, dem Akt des Denkens, des Aufzeichnens vorausginge.
Referenten und Beitragende
Michael Bartsch
Hat Jura studiert und wurde in Wirtschaftswissenschaft promoviert. Er ist Professor für Urheber- und Medienrecht an der Hochschule für Gestaltung Karlsruhe, unterrichtet Softwarerecht an der Universität Karlsruhe und arbeitet als Rechtsanwalt auf diesen Gebieten. Seine Liebe gehört der Literatur und der Musik.
Cristina C. Burckas
Psychoanalytikerin, seit 1989 niedergelassen in freier Praxis in Freiburg i. Br. – Gründungsmitglied der »Assoziation für die Freudsche Psychoanalyse« – Mitgründerin des »Psychoanalytischen Kollegs« – Mitglied und Weiterbildungsdozentin am »Institut für Psychoanalyse und Psychotherapie« in Freiburg i. Br. (DPG) – Mitglied der »Féderation Europeenne de Psychanalyse« – Mitglied der »Association Lire Dolto Aujourd´hui« – Verschiedene Veröffentlichungen zur psychoanalytischen Praxis in deutscher, spanischer und französischer Sprache.
Gabrielle Devallet-Gimpel
Dr. med., Psychiaterin und Psychoanalytikerin in Toulouse-Blagnac (Frankreich). Medizinstudium in Heidelberg und psychiatrische Ausbildung in Toulouse. Langjährige Teilnahme am »Collège Clinique de Psychanalyse du Sud-Ouest« (dem »Forum du Champ Lacanien« zugeordnet), Mitglied der »Assoziation de Psychanalyse Jacques Lacan« und der »Assoziation für die Freudsche Psychoanalyse«.
Miriam Goretzki-Wagner
M.A. Studium Philosophie, Anglistik, unterrrichtete Philosophie in Großbritannien (College) und in Deutschland. Jetzt in eigener Praxis als »Life Coach«. Kollegiatin des »Psychoanalytischen Kollegs«. Schreibt ein Buch über Beratung und die Frage, was geschieht, wenn psychoanalytisches Hören die Praxis der Beratung öffnet.
Britta Günther
Psychoanalytikerin in Hamburg und München. Gehört dem »Psychoanalytischen Kolleg« an, dem »German Ivrit Psychoanalytical Seminar« und der »Freud Research Group« der »International Society of Psychoanalysis and Philosophy«. Tätig als Dozentin u.a. im Rahmen von pli, an der LMU München sowie in der Psychosomatischen Klinik Bad Neustadt.
Annemarie Hamad
Psychoanalytikerin in Paris, Praxis mit Erwachsenen und Kindern. Korrespondierendes Mitglied der AFP.
Christian Kläui
Dr. med., Psychoanalytiker und Psychiater in Basel. Gründungsmitgied der AFP, Mitherausgeber des RISS. Publikationen im RISS, im »Jahrbuch für klinische Psychoanalyse«. Buchpublikation: »Psychoanalytisches Arbeiten. Für eine Theorie der Praxis.« Huber, Bern 2008.
Anna Elisabeth Landis
Dr. med., Fachärztin für Psychosomatik und Psychotherapie sowie für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychoanalyse, Ärztliches Qualitätsmanagement. Seit 10 Jahren als Psychoanalytikerin in eigener Praxis in Böblingen, davor in leitender Stellung am Zentrum für Psychiatrie in Calw. Langjährige psychosomatische Konsiliartätigkeit am Allgemeinkrankenhaus Sindelfingen.
Interessensschwerpunkte: Metapsychologie, Qualitätsmanagement für Psychoanalytiker.
Michael Meyer zum Wischen
Dr. med., Psychoanalytische Praxis in Köln. Facharzt für Psychotherapeutische Medizin. Mitglied der »Assoziation für die Freudsche Psychoanalyse« und der »Freud-Lacan-Gesellschaft Berlin«. Mitgründer des »Psychoanalytischen Kollegs«. Veröffentlichungen zur Psychosetheorie (z.B. im »Jahrbuch für klinische Psychoanalyse«, im »transcript Verlag« und im »Berliner Brief der FLG«). Tätigkeit in Supervision und Kontrollanalyse.
Weitere Interessenschwerpunkte: Geschichte der Psychoanalyse, Psychoanalyse und Kunst.
André Michels
Dr. med., Psychiater und Psychoanalytiker in Luxemburg und Paris, zahlreiche Veröffentlichungen zu klinischen, literarischen und kulturkritischen Themen, Mitherausgeber u.a. vom »Jahrbuch für klinische Psychoanalyse«,Tübingen, 8 Bände, Hsg. von »Actualité de l’hystérie, Érès«, Toulouse 2001. Derzeit Vorsitzender der »AFP«, Mitbegründer des »Psychoanalytischen Kollegs«.
Regelmäßige Seminare und Vorlesungen über Theorie und Praxis der Psychoanalyse.
Peter Müller
Dr. med., Psychoanalytiker in Karlsruhe. Facharzt für Psychotherapeutische Medizin. Gründungsmitglied der »AFP« und des »Psychoanalytischen Kollegs«. Veröffentlichungen und Vorträge zu Klinik und Grundlagen der Psychoanalyse, Mitherausgeber des »Jahrbuchs für klinische Psychoanalyse«. Langjährige Tätigkeit als psychoanalytischer Supervisor in verschiedenen Einrichtungen.
Karl-Josef Pazzini
Professor für Bildende Kunst & Erziehungswissenschaft (Universität Hamburg), Psychoanalytiker in eigener Praxis, Mitbegründer der »Assoziation für die Freudsche Psychoanalyse«, des »Psychoanalytischen Kollegs« und des Jüdischen Salons im Grindel (Hamburg), Mitherausgeber der Reihen »psychoanalyse« und »Theorie Bilden« (transcript), »Kunstpädagogische Positionen« (Hamburg University Press). Arbeit an: Wahn-Wissen-Institution, Bildung vor Bildern, Psychoanalyse & Lehren, Setting in der Psychoanalyse, Unschuldige Kinder.
Siehe auch: http://mms.uni-hamburg.de/blogs/pazzini, http://freudlacan.de, http://www.cafeleonar.de/
Claus-Dieter Rath
Dr. rer. soc., Psychoanalytiker in Berlin. Veröffentlichungen über Fragen der psychoanalytischen Praxis, der Geschichte der Psychoanalyse und über die Massenpsychologie des Alltagslebens (wie Massenmedien, Autobiographien, Esskultur, die Wiederkehr des »Volks«), Mitherausgeber von: (mit Jutta Prasse) »Lacan und das Deutsche. Die Rückkehr der Psychoanalyse über den Rhein«, Freiburg i. Br. 1994; (mit André Michels, Peter Müller, Achim Perner) »Jahrbuch für klinische Psychoanalyse«, Tübingen 1998 ff. Gründungsmitglied von: »Fondation Européenne pour la Psychanalyse« (1991); »Assoziation für die Freudsche Psychoanalyse« (1994); »Freud-Lacan-Gesellschaft«; »Psychoanalytische Assoziation Berlin« (1997); »Psychoanalytisches Kolleg« (2004).
Karin Schlechter
Bildende Künstlerin; Raum-und Videoinstallationen, Performances. Studium in Köln, lebt und arbeitet in Köln. Zahlreiche Einzelausstellungen im In- und Ausland. Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit KünstlerInnen anderer Sparten. 1992 Gründung des Kunstvereins Projekt Herzgehirn e.V. Köln, 1995 des Künstlerinnen-Netzwerks Köln. 2005 Gründung der SCHULE DES BEGEHRENS in Köln. 2008 Gründungsmitglied von textura, Arbeitsgruppe Kunst und Psychoanalyse, Köln. Publikationen und Katalogbeiträge, zuletzt: »mein paradies«, Schlosskirche Bonn.
Marianne Schuller
Prof. Dr. phil., lehrt am Institut für Neuere deutsche Literatur und Medienkultur der Universität Hamburg. Gründungsmitglied des Zentrums für Geschlechterforschung, Universität Hamburg.
Arbeitsschwerpunkte bzw. Schwerpunkte der Lehre (Vorlesungen und Seminare): Literaturwissenschaft mit kulturwissenschaftlicher Ausrichtung, Literatur und Wissen: Medizin/Psychiatrie und Psychoanalyse, Theater unter der übergeordneten medientheoretischen Problemstellung ›Der Körper im Blickfeld und Sprachraum des Theaters‹. Literaturwissenschaft und ›szenische Texte‹. Diese Schwerpunkte werden durchzogen von der Frage der Geschlechterdifferenz. – Literatur und Musik. Gender Studies.
Veröffentlichte auch im »Jahrbuch für klinische Psychoanalyse«. Mitglied der »AFP«.
Michael Schmid
Psychoanalytiker in Bregenz. Mitherausgeber des Lacan-Archivs. Mitherausgeber des RISS. Gründungsmitglied der »AFP«.
Bernhard Schwaiger
Dr. phil., psychoanalytisch arbeitender Psychologischer Psychotherapeut im Jugendstrafvollzug Mecklenburg-Vorpommern, Mitglied der »Freud-Lacan-Gesellschaft Berlin«, Veröffentlichungen u.a. ›Das Begehren des Gesetzes – Zur Psychoanalyse jugendlicher Straftäter‹, Transcript-Verlag, Bielefeld (2009).
Jean-Renaud Seba
Professor für philosophische Anthropologie an der Universität Liège. Hat sich eingehend mit dem Werk von Pierre Legendre befasst. Veröffentlichung u.a.: »Le partage de l‘empirique et du transcendantal: essai sur la normativité de la raison: Kant, Hegel, Husserl«, Ousia, 2007.
Peter Sloterdijk
Studierte von 1968 bis 1974 in München und an der Universität Hamburg Philosophie, Geschichte und Germanistik. 1972/73 Essay über Michel Foucaults strukturale Theorie der Geschichte. Im Jahre 1976 wurde Peter Sloterdijk aufgrund seiner von Professor Klaus Briegleb betreuten Doktorarbeit zum Thema »Literatur und Organisation von Lebenserfahrung. Gattungstheorie und Gattungsgeschichte der Autobiographie der Weimarer Republik 1918–1933« durch den Fachbereich Sprachwissenschaften der Universität Hamburg promoviert.
Seit den1980er Jahren freier Schriftsteller. 1983 Kritik der zynischen Vernunft. Von 1992 bis 1993 hatte er den Lehrstuhl für Philosophie und Ästhetik an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe inne. 1993 Leiter des Institutes für Kulturphilosophie an der Akademie der bildenden Künste in Wien. Seit 2001 ist Sloterdijk in Nachfolge von Heinrich Klotz Rektor der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe.
Georg Christoph Tholen
Gründungsmitglied der AFP. Studierte Philosophie, Soziologie und Psychologie. Seit 1980 Geschäftsführer und stellvertretender Direktor am Wissenschaftlichen Zentrum für Kulturforschung (Schwerpunkt Medienforschung seit 1985) an der Universität Kassel. Seit 1996 Vorstandsmitglied. Kooperation mit verschiedenen Forschungsprojekten mit dem Collège International de Philosophie, Paris (u.a. mit Jacques Derrida, Jean-François Lyotard und Paul Virilio). 1986 Promotion: »Wunsch-Denken. Versuch über den Diskurs der Differenz.« November 1995 Habilitation. 1999 bis 2000 Vertretungsprofessor für Kulturtheorie der Medien, Theorien vergleichender Bildlichkeit an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Seit 2001 Ordinarius für Medienwissenschaft am Institut für Medienwissenschaft der Universität Basel (Grundlagenreflexion mit kulturwissenschaftlichem Schwerpunkt).
Anna Tuschling
Studium der Germanistik, Psychologie und Medienwissenschaft in Marburg, Trier, Bremen und Basel. 2003 Diplom in Psychologie an der Universität Bremen, 2006 Promotion an der Universität Basel zum Thema »Die Figur des Dritten im Klatsch. Zur Medienkulturanalyse des Chattens«. Seit Oktober 2006 Assistentin am Institut für Medienwissenschaft der Universität Basel (Ordinariat Georg Christoph Tholen). Forschungsaufenthalt bei Professor Avital Ronell am German Department der New York University von März bis Juni 2006. Mitglied der »Assoziation für die Freudsche Psychoanalyse« seit Frühjahr 2007.
Dietrich Pilz
Jg. 1946, Dipl.Psych., Dr. phil., arbeitet seit 1990 als Psychotherapeut und Psychoanalytiker in Berlin, Mitglied der »Freud-Lacan-Gesellschaft Berlin«.
Werner Prall
Dr. phil., Psychoanaytiker in Privatpraxis. Senior Lecturer in Psychoanalysis an der Middlesex University, London. Supervisor in mehreren Psychotherapie Ausbildungssinstituten. Mitglied der Guild of Psychotherapists und des College of Psychoanalysts und dessen Board of Govenors. Vertritt die Guild of Psychotherapists bei UKCP (UK Council of Psychotherapy). In dieser Eigenschaft am gegenwärtigen politischen Prozess der Regulierung der Psychotherapie in Grossbritannien beteiligt.
Rivka Warshawsky
Psychoanalytikerin in Tel Aviv nach Freud und Lacan. Mitglied von GIEP, der israelischen Gruppe der New Lacanian School. Professur an der Universität Bar Ilan in der Schule für Psychotherapie. Gründungsmitglied der Lacan-Bewegung in Israël. Redaktionsmitglied in verschiedenen englischsprachigen lacanianischen Zeitschriften.
Peter Weibel
Künstler, Autor, Kurator Kunst- und Medientheoretiker. Studium der Literatur, Philosophie, Medizin, Logik und Film in Paris und Wien. In seinen Studienjahren befasste er sich mit den Schriften Lacans. Seine interdisziplinär ausgerichtete wissenschaftliche und künstlerische Tätigkeit umfaßt literarische, fotografische, grafische, plastische und digitale Arbeiten.
Seit 1999 Vorstand des Zentrums für Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe. Zahlreiche Publikationen. Zum 150. Geburtstag von Sigmund Freud kuratierte er zusammen mit Franz Kaltenbeck im ZKM die Tagung: »Immer noch Unbehagen in der Kultur?« Mit gleichnamigem Titel erschien ein Band mit den Beiträgen zu dieser Tagung (Diaphanes 2009).
Peter Widmer
Dr. phil., Psychoanalytiker in freier Praxis in Zürich. Lehraufträge an Universitäten und Hochschulen, Gastprofessuren an der Universität Kyoto und an der Columbia University. Initiant und Mitbegründer der Zeitschrift RISS und des Lacan Seminar Zürich, Gründungsmitglied der »Assoziation für die Freudsche Psychoanalyse«. Autor von »Subversion des Begehrens« (Turia und Kant, Wien) sowie der beiden im transcript-Verlag erschienenen Bände »Angst. Erläuterungen zu Lacans Seminar X« (2004) und »Metamorphosen des Signifikanten. Zur Bedeutung des Körperbildes für die Realität des Subjekts« (2006). Mitherausgeber des AFP-Bandes »Psychosen: eine Herausforderung für die Psychoanalyse« (transcript 2007).
Organisatorisches
Koordination – Information – Anmeldung:
Dr. Peter Müller, Tel.: +49 721-20735, Fax.: +49 721-23800,
E-Mail: petjanik@t-online.de
Bankverbindung
Kto-Nr. 2322676, BLZ 660 202 86
HypoVereinsbank Karlsruhe
IBAN 96660202860002322676, swift-code: HYVEDEMM475
Sekretariat der AFP
c/o Hans-Peter Jäck, Keplerstraße 5 A, D-60318 Frankfurt a.M.
Tel.: +49 69 558124, Fax: +49 69 5969009, Hpjk@aol.com
Entsprechende Fortbildungspunkte sind beantragt.
AFP im Internet: http://www.freudlacan.de
Ort
Hochschule für Gestaltung Karlsruhe im Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM), Lorenzstraße 15, Lichthof 2
Eintrittspreise
Bei Bezahlung bis 31. Januar 2010 sind es 100 Euro, danach 120 Euro. Mitglieder der AFP bezahlen 80 Euro,
Studenten 50 Euro. In diesem Preis ist der Empfang am Freitagabend enthalten. Zahlbar per Überweisung mit dem Verwendungszweck »Kongress Karlsruhe«.
Hotelempfehlung
Im Hotel Rio ist ein Kontingent von Zimmern (EZ 76 Euro,
DZ 88 Euro) vorreserviert. Buchung bitte per mail an meine Adresse oder direkt unter Tel. 0721-84080